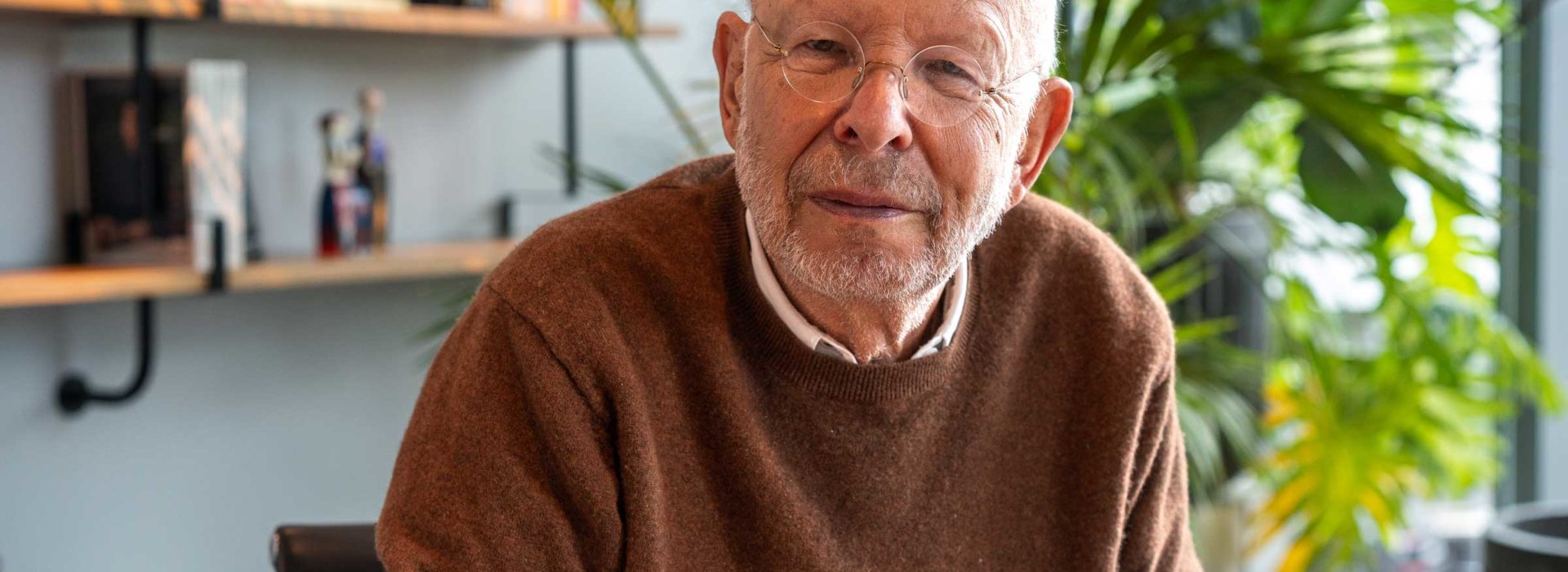Deutschland hat sich viel vorgenommen: Aufarbeitung, Schuldbewusstsein, Erinnerungsarbeit. Kaum ein Land hat seine eigene Geschichte mit solcher Ernsthaftigkeit seziert, kommentiert, in Stein gemeißelt. Und doch: Der Antisemitismus ist nicht verschwunden. Er hat sich nur verwandelt. Vom groben Hass zur subtilen Ausgrenzung, von der Straßenecke in akademische Diskurse, von neonazistischen Randgruppen in die bürgerliche Mitte. Der Schriftsteller Rafael Seligmann nennt ihn das „Fieber der Gesellschaft“: Wenn es steigt, ist das kein Symptom des Judentums, sondern eines allgemeinen gesellschaftlichen Unwohlseins. Judenfeindschaft, so Seligmann, ist ein „Seismograph für gesellschaftliche Krisen“.
Seit dem 7. Oktober 2023, seit dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel, ist der Antisemitismus in Deutschland nicht nur sichtbarer geworden, sondern auch hemmungsloser. Die Differenzierung zwischen Israelkritik und Judenhass verschwimmt. „Israel hat eine kritikwürdige Regierung, ja. Aber niemand spricht von Russlandkritik, wenn man Putin verurteilt“, sagt Seligmann. Er warnt vor einer Sprache, die unter dem Deckmantel politischer Argumente alte Feindbilder reaktiviert.
Die falsche Schonzeit
Der Titel von Seligmanns neuem Buch, „Keine Schonzeit für Juden“, bezieht sich auf ein Zitat des Intendanten Günther Rühler aus dem Jahr 1985. Doch Seligmann stellt klar: „Wir brauchen keine Schonzeit. Wir brauchen Gleichbehandlung.“ Der Satz offenbart eine fatale Schieflage im gesellschaftlichen Denken. Eine Schonzeit suggeriert Schutz, der nicht auf Gleichheit basiert, sondern auf Ausnahmestatus. Doch wahre Integration braucht keine Sonderregelung. Sie braucht Respekt. Und Sichtbarkeit.
Gerade daran fehlt es, sagt Seligmann. In der jüngeren Generation seien jüdische Stimmen im öffentlichen Diskurs zu selten. „Es gibt kaum jüdische Gegenwartsliteratur in Deutschland. Weil viele denken: Wenn ich über jüdisches Leben schreibe, wird mir Antisemitismus entgegenschlagen.“ Sichtbarkeit, so sagt er, erfordert Mut. „Leben heißt Mut.“
Wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich als Jude – weil ich Jude bin. Wäre ich eine Frau, würde ich als Frau schreiben.
Rafael Seligmann
Dabei wäre die Chance da gewesen: Nach 1989 wollten viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommen. Doch die Bundesrepublik öffnete die Tür nur spaltweise. „Man hätte dem Land eine neue jüdische Präsenz geben können. Aber man wollte möglichst wenig Juden“, so Seligmann. Statt einer Million kamen nur 200.000. Die anderen gingen nach Israel und trugen dort zum Aufstieg der Hightech-Nation bei.
Der Mensch im Mittelpunkt
Was bleibt, ist ein Appell an die Gesellschaft. Nicht als Mahnung, sondern als Einladung zur Humanität. „Antisemitismus ist Menschenhass“, sagte auch die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch. Er ist nie allein, sondern geht Hand in Hand mit Homophobie, Rassismus, Ausgrenzung. „Wenn man jedem Menschen seine Würde gibt, klappt es in einer Gesellschaft“, sagt Seligmann. Und erinnert daran, dass die Basis dafür bereits existiert: Artikel 1 des Grundgesetzes.
Es ist eine klare Forderung: Weniger Prinzipien, mehr Taten. Statt sich in Schuldfragen der Vergangenheit zu verfangen, geht es um Verantwortung für die Gegenwart. Wer sich selbst verbessert, macht die Gesellschaft menschlicher. Dann, so Seligmann, „fällt der Antisemitismus in sich zusammen“.