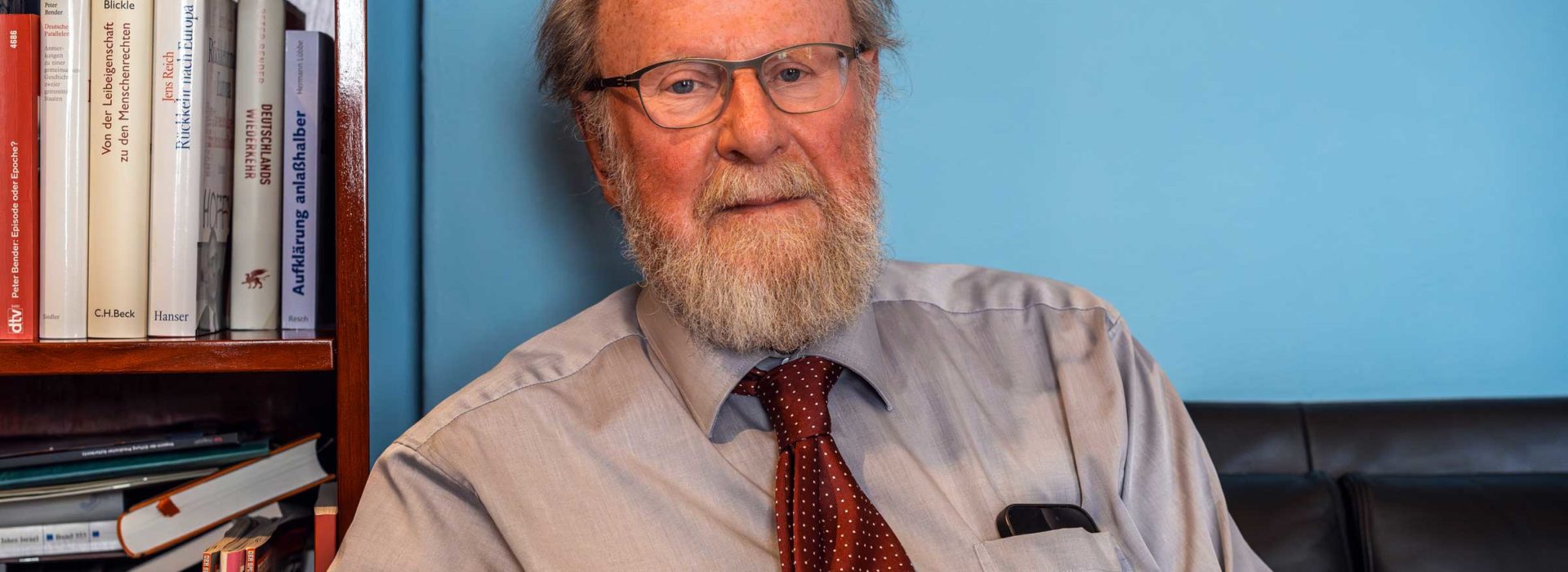Es ist eine Zeit der Zumutungen. Wer die Weltlage betrachtet, sieht nicht nur ein Problem, sondern viele: Krieg, Klimakrise, Migrationsdruck, digitale Umbrüche und ein wachsendes Misstrauen gegenüber Institutionen. Die Gleichzeitigkeit all dieser Krisen erzeugt eine Erschöpfung, die in der Gesellschaft tief wirkt. Und sie stellt die demokratische Politik auf die Probe.
Wolfgang Thierse, früherer Bundestagspräsident, nennt diese Gleichzeitigkeit „unerhört viel“. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, wie sehr sich diese Verdichtung von Krisen auf die demokratische Kultur auswirkt. „Wir erleben Zeiten, die ziemlich brutal sind“, sagt Thierse. Und weiter: „Politik kann diese Probleme nicht so schnell bewältigen, wie eine ungeduldige, verunsicherte Menschheit es sich wünscht.“
In solchen Momenten ist es besonders schwer, zu regieren. Und doch erwarten viele Bürgerinnen und Bürger schnelle Lösungen, klare Aussagen, am besten: einfache Antworten. Doch Demokratie funktioniert anders. Sie ist langsam, umständlich, voller Kompromisse. Sie ist eben keine autoritäre Maschine zur schnellen Beruhigung kollektiver Angst.
Die Versuchung der einfachen Wahrheit
Gerade das macht sie in Zeiten wie diesen angreifbar. Populisten leben von der Behauptung, man müsse sich nur trauen, hart durchzugreifen. Der starke Mann, der den gordischen Knoten durchschlägt – diese Figur erlebt eine Renaissance. Der Preis wäre hoch: den Verlust dessen, was in Europa mühsam errungen wurde.
„Die Sehnsucht nach der einfachen, klaren Antwort ist riesengroß geworden“, sagt Thierse. Und er warnt: „Das ist ein hochgefährliches Moment für die Demokratie.“ Wer das Fremde fürchtet, wer Komplexität ablehnt, ist anfällig für jene, die einfache Lösungen versprechen. Dass die AfD damit Erfolg hat, wundert Thierse nicht. „Sie profitieren von der Erschöpfung und dem Unwillen zur Veränderung.“
Dabei gerät auch der demokratische Diskurs zunehmend unter Druck. In sozialen Netzwerken entstehen Echokammern, in denen sich Vorurteile bestätigen und Wirklichkeitswahrnehmungen zersetzen. „Demokratie lebt davon, dass die Gesellschaft eine ungefähre gemeinsame Wirklichkeitswahrnehmung hat“, sagt Thierse. „Wenn das verloren geht, wird Debatte unmöglich.“
Politik ist keine Dienstleistung
In Gesprächen über Politik zeigt sich oft ein tiefes Missverständnis: Viele erwarten von der Demokratie, sie möge Probleme lösen wie ein Dienstleister. Doch Demokratie ist kein Lieferdienst für perfekte Entscheidungen. Sie ist ein Angebot zur Mitgestaltung. Ihre Wirksamkeit hängt davon ab, ob Menschen sich beteiligen – nicht nur mit Forderungen, sondern mit Verantwortung.
Viele fühlen sich sprachlich bevormundet. Nicht weil sie ihre Meinung nicht sagen dürften – sondern weil sie glauben, dafür sofort als reaktionär abgestempelt zu werden.
Wolfgang Thierse
Gerade das ist unbequem. Denn es bedeutet: Probleme lassen sich nicht ohne Veränderung lösen. Und Veränderung tut weh. Das gilt für Sozialreformen ebenso wie für Klimaschutz, für Migration ebenso wie für Bildung. Wer all das will, darf nicht glauben, dass es ohne Zumutung geht.
Thierse beobachtet dabei auch ein Missverhältnis in der politischen Kommunikation: „Es gibt in der Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern eine eigentümliche Vorwurfsdistanz“, sagt er. „Demokratie lebt aber vom Gespräch von Bürger zu Bürger, von Nachbar zu Nachbar.“ Und er erinnert daran, dass auch der Sozialstaat eine gemeinsame Leistung sei: eine europäische Errungenschaft, keine Selbstverständlichkeit.
Die Ermutigung liegt vielleicht in einem Satz von Vaclav Havel, den Thierse im Gespräch zitiert: „Hoffnung heißt nicht, dass eine Sache gut ausgeht, sondern dass sie in sich vernünftig und richtig ist und sich dafür einzusetzen lohnt.“
Podcast anhören:
- Spotify
- Apple Podcasts
- Deezer
- YouTube